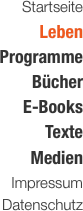
|
 |

Psychogramm
Das Licht der Welt
Nein nein
Das kann es nicht gewesen sein
Es war Schreien Strampeln Atmen und wieder Schreien
Komplizierte Lage
Kaiserschnitt
Beide Füße 180 Grad nach innen
Spitzfuß
Achillessehne musste sofort verlängert werden
Narkose
Nun lässt sich alles erklären
Ständiger Umgang mit Betäubungsmitteln
Defensive Eskapismus Hinnehmer Außenseiter
Clown Narr
Vater
Rührend schwach kein Durchsetzer
Überfordert Tenor Runterschlucker
Christ Wagnerianer
Mutter
Melancholisch soll gerne gelacht haben
Sehr beliebt dunkle Schönheit
Lieblingslied
Alle Tage ist kein Sonntag
Manisch depressiv
Wollte dass Sohn Arzt wird
Virchow-Komplex
Streng
Enttäuscht starb 35 Sohn Sextaner
Aha
Dann alles soeben
Gymnasium soeben
Abitur soeben
Alles flüchtig flächig
Motorik blockiert
Also
Lesen
Also
Musik hören
Immer wieder lesen und Musik hören
Bücher über Expeditionen
Auf den höchsten Berg
Oder ins tiefste Innere
Na ja typisch
Am liebsten Expeditionen
Die danebengingen
Tagebücher nach 30 Jahren gefunden usw.
Ein bisschen Tonio Kröger
Leichte Verwahrlosungstendenzen
Abgefangen durch kleinbürgerliche Disziplin
Durchkompensiert durchmotiviert
Von Verwandten
Insbesondere von Tante Liese
Mit großer Güte umsorgt
Sorgenkind
Onkel Hein Schneider und Dirigent bringt Literatur
In das Kind
Gedichte lernen und vortragen
Auf der Schneiderstube
Claudius
Mit 14 Jahren letzte Operation
Linker Mittelfußknochen raus
Dann Klavierstunde
Lieblingssonate Clementi Didone abbandonata
Entdeckung von Impressionisten und Expressionisten
Musikalisch literarisch
Sprache und Musik als Medizin
In der Schule Spitzname Spinner
Kein Soldat
Fußleiden wird zum Rettungsring
Um Wunsch der Mutter nachzukommen
Ein Semester Medizin in Gießen
Von SS-Studenten wegen zu langer Haare
Aus dem Hörsaal entfernt
Anatomie Professor Wagenseil
Dann Kriegsende abgewartet
Warten auf sogenannte Toleranz sogenannten Antifaschismus
Sogenannten Pazifismus sogenannten Sozialismus
Dann
Studium in Mainz
Theaterwissenschaften Literatur und Musik
Da keine wissenschaftliche Natur
Sondern eine lyrische
Bald die ersten Chansons Gedichte und Geschichten
Ehe mit »Frieda«
Eine Tochter
Inzwischen sieben Katzen
Und immer wieder Expeditionen
Auf den höchsten Berg
Oder ins tiefste Innere
Lieblingsautoren der Reihe nach
Tucholsky Brecht Benn Beckett
Und Thomas Bernhard
Heute immer nur in allen Taschen und Mappen
Auf allen Tischen Schreibtischen und Nachttischen
Thomas Bernhard
Na ja
Und das andere das »Positive« das Leuchtende
Das Hoffende
Das Spielerische das Engagierte das Produktive
Das Narzisstische
Das Relativistische das Unterhaltende das Politische
Das Poetische
Usw. usw. usw. usw. usw.
Das kennen Sie ja.
Hanns Dieter Hüsch, 1975
© Chris Rasche-Hüsch
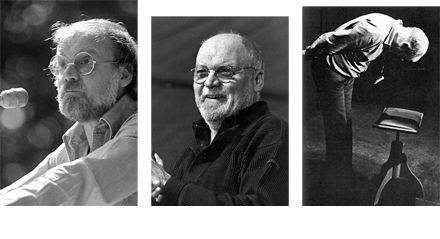
Das Leben als eine Parodie auf sich selbst begreifen
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich Hanns Dieter Hüsch das erste Mal gehört und gesehen habe. Es muss, denke ich, Anfang bis Mitte der sechziger Jahre gewesen sein. Ich war damals noch auf einem furchtbaren mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium inhaftiert und rannte mindestens einmal die Woche abends in die Uni, wo der AStA oder die Fachschaften oder irgendwelche Arbeitsgruppen ein Unterhaltungsprogramm boten: politische Diskussionen, Filme, Konzerte, Kabarett, Theater. Ich weiß auch nicht mehr, was ich alles damals gesehen habe. Ich erinnere mich noch an Filmvorführungen im Audimax, vor allem deswegen, weil vor jedem Film ein bemühter Cineast eine »Einführung« gab, die als Grundlage für eine Diskussion hinterher dienen sollte, während der ganze Saal pfiff und trampelte und Beifall klatschte, wenn ein Papierflieger das Rednerpult traf. So hatte ich von der akademischen Ausgelassenheit schon eine gute Vorstellung, lange bevor ich selbst ein kurzes Gastspiel auf der Uni gab. Die Kleinkunst fand nicht im Audimax, sondern im Hörsaal 1, dem größten Raum im WiSo-Gebäude statt. Ich kann mich heute nur noch an zwei Namen erinnern: die großartige Hannelore Kaub mit ihrem »Bügelbrett« aus Heidelberg und eben Hanns Dieter Hüsch. Hüsch trat damals in einem knallroten Nicki-Wollpullover auf – das war sein Markenzeichen – und spielte nicht auf einer kleinen Orgel wie heute, sondern auf einem schwarzen Konzertflügel. Er musste sich dabei immer etwas nach rechts drehen, um quasi über die Schulter zum Publikum zu sprechen. Es empfahl sich, nicht in der linken Saalhälfte zu sitzen, man bekam dort von seiner Mimik nicht viel mit.
Ich saß damals also, ein sechzehnjähriger Unter- oder Obersekundaner, mitten unter Studenten, die sich gegenseitig siezten und mir furchtbar alt vorkamen, und genoss den Anschauungsunterricht, was man – was einer – mit der Sprache machen kann. Ich konnte damals schon ordentlich Deutsch sprechen und auch schreiben – jedenfalls besser als die meisten meiner Lehrer –, aber es war die blutleere und formalisierte Gymnasialsprache, die man mir beigebracht hatte und die sich nur zum Schreiben von Besinnungsaufsätzen eignete, wo es darauf ankam, mit einem Minimum an Wissen ein Maximum an Eindruck zu schinden. Hüsch führte mir vor, was für eine Vitalität und Genauigkeit die deutsche Sprache haben kann, wenn sie einer so beherrscht und handhabt wie er. Dass hinter dieser anderen Sprache ein vollkommen anderes Denken steckte, das war mir damals noch nicht bewusst. Während wir auf der Schule auf den Frust des Lebens dadurch vorbereitet wurden, dass man uns unter der ständigen Drohung von blauen Briefen, Nichtversetzung und Strafarbeiten über Toleranz, Selbstentfaltung, Moral und andere globalkonkrete Themen schwadronieren ließ, die mit uns selbst nichts zu tun hatten, nahm sich Hüsch die kleinen Dinge vor, die jeder aus seiner eigenen Umgebung kannte, und stellte sie so dar, dass ihre Absurdität klar wurde. Er machte nichts anderes als »zuhören, zugucken, aufschreiben, vortragen«, wie er in einem Text mal erklärte. Ich erinnere mich an zwei Stücke, die mich damals maßlos beeindruckten: die Beschreibung einer abendlichen Familienszene und einen Text, der mit dem Satz anfing: »Ach, schick doch dein Kind auf ein humanistisches Gymnasium …«, in dem Hüsch durch Wortspielereien (»Mens sana in corpore sanatorium«) die bildungsbürgerlichen Ideale als einen Haufen Lüge und Verklemmung entschleierte.
Ich blieb an Hüsch dran, besuchte fast jedes seiner »Konzerte«, lernte ihn irgendwann kennen, machte eine größere Radiosendung mit Hüsch über Hüsch und vor einem Jahr zusammen mit Frans van der Meulen einen Hüsch-Film fürs Fernsehen. Meine emotionale Begeisterung und intellektuelle Wertschätzung für ihn hat heute eine andere Grundlage als zu der Zeit, da ich nach jeder Pointe griff, die mir den Mief und den Muff der Schulzeit überstehen half. War Hüsch damals das geistige Gegenstück zu den promovierten Ignoranten, die sich anmaßten, uns zu erziehen, so ist er heute für mich nicht nur ein Begriff für gute Unterhaltung, sondern so etwas wie ein Programm für eine Lebenseinstellung, die ich »alternativ« nennen würde, wäre dieser Begriff nicht so schrecklich abgedroschen und von den Makrobioten so eindeutig besetzt. Mit »alternativ« meine ich etwas anderes, etwas, wofür es keine fertigen Etiketten gibt. Ich will versuchen, diese Haltung zu beschreiben: Hüsch ist eitel und bescheiden zugleich. Er ist eitel in seinen Stücken, die nur er vortragen kann und die nur so vorgetragen werden können, wie er sie vorträgt. Es gibt keinen Hauch von Entfremdung zwischen ihm und seinen Texten. Dies ist wohl der Grund dafür, dass es keine Hüsch-Epigonen oder Imitatoren gibt, während ganze Scharen von Jungsängern Reinhard Mey nachmachen. Hüsch ist bescheiden, weil er im Gegensatz zu linken und rechten Besserwissern und Wegweisern keine Rezepte gibt, keine Wirkung für sich reklamiert, die seiner Arbeit einen »höheren« Sinn geben soll. Er sagt: »Ich spiele für mich, ich schreibe für mich, nicht für irgendein Publikum.« Und es gibt viele, die gerne zuhören und zugucken, wenn er für sich spielt. Hüsch, der für sich spielt, braucht ein Publikum, vor dem er spielen kann. Hüsch nennt sich selbst einen »Relativisten«; in seinen Texten gibt es ein paar Bilder und Wendungen, die immer wieder vorkommen: »Am besten ist es, aus dem Weg zu gehen …« – »… die Geschichte überspringen« – »… sich aus der Schöpfung schleichen«; das klingt wie Resignation, aber ich glaube, es ist die demonstrative Abkehr von Leuten, die nicht aus dem Wege gehen, sondern andere auf einen Weg schicken; die die Geschichte nicht überspringen, sondern machen; die sich nicht aus der Schöpfung schleichen, sondern ihr den Stempel aufdrücken wollen. In einer Gesellschaft, in der ein jeder ganz genau weiß, wo es langzugehen hat, ist ein Relativist wie Hüsch nicht nur eine Ausnahme, sondern geradezu eine Wohltat. In seinem Text »Weltende« sagt er unter anderem: »Die Dichter hören auf zu dichten, die Beweiser hören auf zu beweisen, die Erzieher hören auf zu erziehen, die Reisenden hören auf zu reisen, die Flüchtlinge hören auf zu fliehen, die Historiker hören auf zu analysieren, die Humanisten hören auf zu bewegen, die Fanatiker hören auf zu soufflieren, die Erlöser hören auf zu erlösen, die Beleger hören auf zu belegen, denn jeder sieht es allmählich ein – es muss nicht sein: Man kann es lassen und der Geschichte den Abschiedskuss verpassen …« Auch zu seinen eigenen Worten, so Hüsch am Schluss dieses Textes, fällt ihm ein: »Es muss nicht sein, es muss nicht sein.«
Dieses Relativieren wirkt auf viele Leute irritierend, muss auf sie irritierend wirken, weil es zum Grundbestand der Umgangsformen gehört, sich selbst auf- und alle anderen abzuwerten. Hüsch macht es genau umgekehrt. Er relativiert sich selbst, gesteht aber jedem das Recht zu, sich wichtig zu nehmen: »Alles, was wir machen, machen wir uns vor, und alles, was wir uns vormachen, vom Kartoffelschälen bis zur Kunst, alles, was wir uns vormachen, ist wichtig, wir könnten sonst nicht leben.« - »Alles, was wir reden und denken, ist Operette, um die schleichende Krankheit Leben leben zu können …« Und in einem Lied mit dem Titel »Die Gesunden« sagt Hüsch: »Die Gesunden habens gut, denn sie essen schon zum Frühstück eine Lehre …« Die Gesunden sind unbeirrt und haben festen Boden unter den Füßen. Und während alle anderen Songschreiber und Liedermacher gesellschaftlich relevante Arbeit leisten, macht Hüsch nach eigener Aussage »nur dummes Zeug«, er singt »für die Verrückten«, für diejenigen, »die suchen und die niemals finden«.
Es gibt Sätze bei Hüsch, die sind von einer poetischen Kraft und zugleich von einer Konkretheit, dass sich ein Vergleich mit Tucholsky aufdrängt: wenn Hüsch zum Beispiel eine Gegend beschreibt, »wo gelbes Licht sich eitel Heimat schimpft und man die Kinder gegen Außenseiter impft«, oder wenn er sagt: »Das Nichts läuft schon auf vollen Touren«, oder wenn er über einen Abend singt, den die Menschen »Bier bei Fuß« verbringen. In jedem solcher Sätze artikuliert sich die Pathologie des Alltags, die uns nur deswegen nicht bewusst wird, weil sie eben alltäglich und allgegenwärtig ist. »Wir brauchen das Leben nicht zu parodieren«, sagt Hüsch, »es ist schon längst, ohne dass wir es gemerkt haben, eine vollkommen selbständige Parodie geworden.«
Ich bin im Laufe der Jahre immer mehr ein Hüschianer geworden. Hüsch hat mich überzeugt, dass es richtig ist, das Leben als eine Art Parodie auf sich selbst zu begreifen. Wenn ich in einem Café sitze, Bahn fahre oder in einer Redaktion bin, wenn ich Freunde besuche, auf den Markt gehe oder auf die Bank, überall höre ich Hüsch-Sätze, erlebe ich Situationen, wie Hüsch sie auf der Bühne darstellt. Und ich denke mir dann nicht: Der Hüsch macht das prima nach, sondern: Das ist ja genau wie bei Hüsch! Ich vergleiche die Realität mit ihrer Reproduktion. Hör ich einen Politiker mit seinem »autorisierten Radebrechen«, bin ich sicher: Den Text hat der Hüsch geschrieben. »Das Nichts läuft schon auf vollen Touren …« – ich erlebe es täglich: ein Autobahnstau von vierzig Kilometern Länge und gleichzeitig ein Radiokommentar gegen die Einführung eines Tempolimits, Polizeibeamte, die U-Bahn fahren, um dort Terroristen aufzuspüren, die größte Olympiade, die größte Buchmesse, die größte Umweltkatastrophe: »Der Wahnsinn sagt langsam zu uns Du …«
Dies ist auch der Boden, auf dem die Hagenbuch-Geschichten stehen. Ein Einzelner begegnet immer wieder dem Wahnsinn der Mehrheit, die ihn für verrückt hält, weil er nicht so ist wie die meisten. Ich glaube, mehr darf man zu Hagenbuch nicht sagen, um nicht in die Haltung jener zu verfallen, die ständig fragen, was der Dichter »damit« sagen will, weil sie mit dem Gesagten selbst nichts anfangen können. Für die Hagenbuch-Stücke gilt, was für Hüsch überhaupt gilt, er hat es in einem Gedicht mal so beschrieben:
»Gemacht aus Bauern- und Beamtenschwäche
kam ich in diese Welt hinein,
mal dunkler Kern, mal reine Oberfläche
ich habe Angst und muss doch mutig sein.«
Henryk M. Broder, 1978
Henryk M. Broder (*1946 in Katowice) ist Journalist und Buchautor. Von 1995 bis 2010 schrieb er Kolumnen und Reportagen für den »Spiegel«, seit 2011 arbeitet er für die Welt-Gruppe. Für sein Buch »Die letzten Tage Europas. Wie wir eine gute Idee versenken« (Knaus Verlag, 2013) wurde er von der Europa-Union Deutschland mit der »Europa-Distel« für »für seine vornehmlich unsachliche und polemische Europakritik« ausgezeichnet.
»Nathan der Leise«
Seine klare politische Haltung ohne hochschnellenden Zeigefinger, sein Wurzeln im christlichen Glauben ohne missionarische Ambitionen, sein klarer Blick auf menschliche Unzulänglichkeiten, ohne sie vorzuführen – diese Humanität beeindruckte mich gleich bei der ersten »Begegnung« mit Hanns Dieter Hüsch, als er 1977 in Wuppertal gastierte. Und das alles mit einer nahezu sinnlichen Lust an der Sprache, die man eher bei einem Dichter denn bei einem Kabarettisten gesucht hätte. Wie kein Zweiter verstand er es – auf der Bühne und in seinen Texten –, das Komische und das Tiefe, das Leichte und das Schwere miteinander zu verbinden. Ich erinnere mich gut des sparsamen Harmoniumakkords, mit dem er 1995 in seinem Programm »Nachtvorstellung« von der Zeile »Mensch, komm nach Hause und ruh dich aus, es sitzt schon der Abend auf deinem Haus« zu »Schmetterling kommt nach Haus« überleitete.
Wohl niemand – lassen wir die Familie mal außen vor – hat mich so geprägt in meiner Menschen- und Weltsicht wie Hanns Dieter Hüsch. Und als ich Mitte 2013 überlegte, welche verlegerischen Projekte ich gerne noch realisieren würde, stand sein literarisches Werk ganz oben auf der Liste. Die aktuelle Beschäftigung mit seinen Texten war eine einzige Bestätigung der Entscheidung, sie neu – und manche erstmalig – zugänglich zu machen. Erstaunlich, wie wenige der Texte zeitverhaftet sind, erstaunlich, wie aktuell, nein: gültig »Nathan der Leise« (Der Spiegel) ist. Gratulation zum 90., lieber Hanns Dieter!
Helmut Lotz, 2015
Helmut Lotz (*1955 in Wuppertal) ist Lektor, Herausgeber und Verleger der Edition diá.
Fotos oben: Privatarchiv, Privatarchiv, F.Sautier
Fotos unten: Otmar Dills, Bernd Weisbrod, Willi Kraus
|